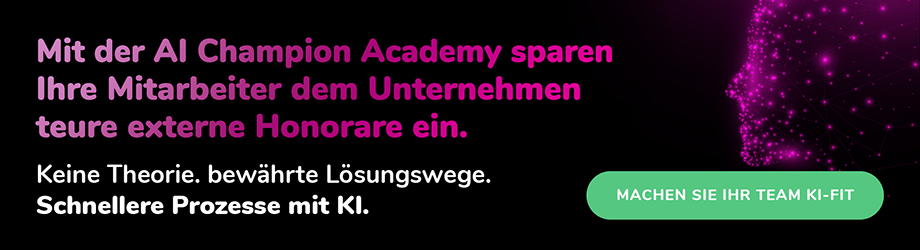Über eine Zeitspanne von fünfzehn Jahren hat ZinCo ein umfangreiches Netzwerk aus Forschungspartnern und Praktikern aufgebaut, um gebietsheimische Biodiversität auf Dachflächen zu etablieren. In Zusammenarbeit mit Hochschulen und dem Bund deutscher Staudengärtner fanden Besichtigungen von Versuchsanlagen in Nürtingen und am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb statt. Zahlreiche Referenzprojekte demonstrieren innovative Substrattechnologien und Wasserspeichersysteme wie Floradrain FD40, Dochtvlies und Retentions-Spacer sowie regionaltypische Sandtrockenrasen. Diese Ansätze belegen die Umsetzung naturnaher Vegetationsmodelle im urbanen Raum.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Nachhaltige Dachgärten entstehen dank ZinCo Substratinnovationen und regionalem Saatgut

Der Blick über die verschiedenen Gründachflächen (Foto: ZinCo)
ZinCo befasst sich seit über fünfzehn Jahren mit der Förderung gebietsheimischer Ökosysteme auf Gründächern. Durch die Kombination aus optimierten Substratsystemen und standortgerechtem Saatgut entstehen auf Industriehallen, Bürogebäuden und Forschungszentren artenreiche Habitate. Diese Dachökosysteme bieten einheimischen Pflanzen und Tieren Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsraum und bilden ökologische Brücken im urbanen Gefüge. Mit diesem Ansatz beweist ZinCo, dass technische Gebäudebegrünung und Naturschutz Hand in Hand gehen können.
Ziel: Verbindung von Forschung und Anwendung auf Gründächern schaffen
Die Veranstaltung in Nürtingen-Geislingen ermöglichte rund achtzig Mitgliedern des BdS-Arbeitskreises Pflanzenverwendung eine intensive Auseinandersetzung mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich extensiver Dachbegrünung. Auf Einladung von ZinCo leitete Prof. Cassian Schmidt praxisorientierte Begehungen mit Fokus auf Substrataufbau und Pflanzenbestände. Ein Exkurs zum Naturschutzzentrum Schopflocher Alb vertiefte das Verständnis für regionale Biodiversitätskonzepte. Ziel war die Förderung nachhaltiger Begrünungspraktiken durch direkten Wissenstransfer und kollaborative Evaluierungen. Workshops und Feldversuche demonstrierten praxisnah innovative ökologische Bewirtschaftungsansätze.
2022 Referenzprojekt nutzt Waldsoden Stecklinge für erfolgreich großflächige Dachbegrünung

Die interessierten Besucher erkunden die verschiedenen Gründächer. (Foto: ZinCo)
In der Kooperation mit ThePlus und BIG entstand 2022 eine praxisnahe Studie für großflächige Dachbegrünungen. Zunächst hoben Planungsteams Waldsoden von benachbarten Waldböden ab und verteilten sie als lebendige Vegetationsdecke auf dem Dach. Gleichzeitig wurden regional gesammelte Stecklinge in abgestimmten Substratschichten angesiedelt. Dieses Referenzobjekt belegt die technische, ökologische und gestalterische Machbarkeit naturnaher Gründächer. Es fungiert als Blaupause für künftige, nachhaltige Bauvorhaben in urbanen Ballungsräumen und bietet praxisorientierte Planungsszenarien und ökologischen Leistungsnachweisen.
Praxisbeispiel zeigt nachhaltige Begrünung mit regionalem Saatgut auf Industriegebäude
ZinCo setzte 2019 auf dem Dach der Lütvogt-Produktionshalle in Wagenfeld gezielt auf regional typisches Saatgut sowie samenhaltiges Rechgut. Die so vorbereitete Substratschicht ermöglichte die Bildung eines charakteristischen Sandtrockenrasens, welcher den natürlichen Trockenrasenstandorten Niedersachsens nachempfunden ist. Dieses Best-Practice-Beispiel belegt, dass Industriegebäude als Biotopflächen nutzbar sind und regionale Pflanzengemeinschaften dauerhaft Bestand haben können, wodurch der ökologische Fußabdruck gewerblicher Anlagen nachhaltig reduziert wird. Die Erkenntnisse unterstützen Planer und Bauherren bei der Entwicklung zukunftsfähiger
Experimentelles nährstoffarmes Vegetationskissen entstand durch Kalkschotter-Mutterboden-Gemisch auf Gefälle-Dächern 2011
Im Jahr 2011 legten Wissenschaftler am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb den Grundstein für ein ökologisches Langzeitprojekt auf Gründächern. Eine Schicht Floradrain FD 40 diente als Wasserpuffer, während Kalkschotter und humoser Mutterboden das Substratprofil bildeten. Nach Mustern des Schwäbischen Kalkmagerrasens entstand auf geneigten Dachflächen und Verbindungstrakten eine Vegetationsdecke mit minimaler Nährstoffversorgung und geringer Artenzahl, die adaptiv an die trockenen Bedingungen angepasst ist.
Kapillare Wasseraufnahme durch integriertem Substratsystem erhöht Überlebensrate unter Trockenheit

Ein Rückschnitt der hochwachsenden Gräser wäre hier empfohlen (Foto: ZinCo)
Der Aufbau des ZinCo-Systems besteht aus einer trapezförmig geformten Floradrain FD 40-Entwässerungsmatte, unterlegt von einem kapillar wirksamen Dochtvlies sowie halbkugelförmigen Retentions-Spacern. Diese Bausteine speichern Regenwasser und geben es durch Kapillarkräfte an das Dachsubstrat ab. Die zusätzliche Integration der Meyer-Methode sorgt über automatische Sensoren dafür, dass Wasserstau vermieden und Trockenzeiten verlängert werden. Dadurch reduzieren sich Bewässerungskosten und der ökologische Fußabdruck. Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit prägen die Systementwicklung modularer Einrichtung für Dachbegrünungsprojekte.
Projekt zeigt nachhaltige Dachflora dank geplanter und spontaner Besiedlungsdynamik
Langjährig angelegte Dachversuche an der HfWU Nürtingen-Geislingen zeichnen ein Bild ökologischer Entwicklung auf Gebäudedächern: Dr.-Ing. Beate Hüttenmoser berichtete von einer Orchideenkolonie, die sich über dreißig Jahre vollkommen selbstständig etablierte. Ergänzend traten Sedum-Arten als spontane Wildformen auf. Diese Kombination zeigt, dass gezielte Begrünung und natürliche Sukzession zusammenarbeiten, um dauerhafte, gebietsheimische Pflanzengemeinschaften zu schaffen und somit die Biodiversität urbaner Dachlandschaften nachhaltig zu steigern. Messreihen bestätigen die positive Wirkung auf Insekten- und Bodenorganismen.
Leitfaden für nachhaltige Dachgärten von Kleinprojekten bis zu Großflächenprojekten
Regionale Biodiversität auf Gründächern wird durch ZinCo über eine abgestimmte Verbindung aus ökotypischer Saatgutmischung, mehrlagigen Substratmatten und integrierten Retensionsmodulen gefördert. Dieser Systemaufbau simuliert natürliche Bodenverhältnisse, hält Niederschlagswasser zurück und gewährleistet optimale Nährstoffversorgung. Eine wissenschaftlich dokumentierte Projektbibliothek und praxisnahe Planungshilfen erläutern Aufbauhöhen, Pflanzenwahl und Bewässerungsintervalle. So erhalten Dachflächen in städtischen und industriellen Kontexten einen ökologischen Mehrwert. Nutzer finden umfassende Anleitungen zur Montage, zum Monitoring und zur dauerhaften Pflege. Dokumentationsextras unterstützen Umsetzung.